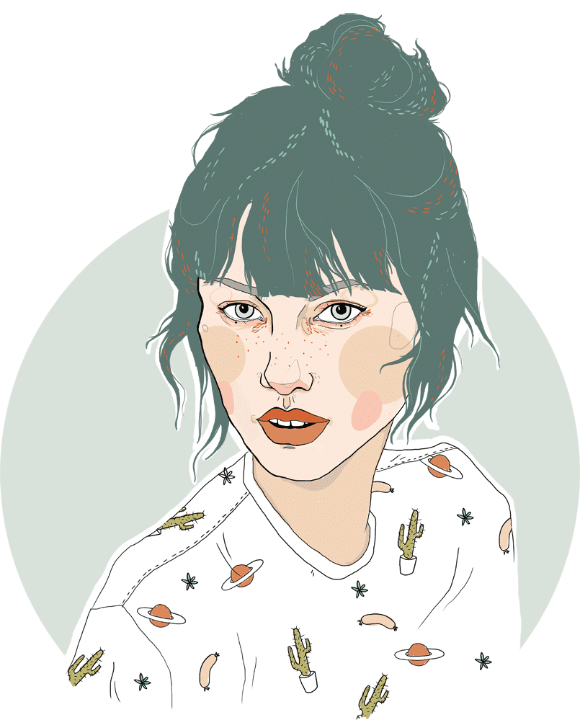Fräulein Flora: In den Anmerkungen zu deinem neuen Roman beziehst du dich auf die Wissenschaftlerin Marie Jahoda, die sich in einer berühmten Studie mit den Arbeitslosen von Marienthal beschäftigt hat. War diese Auseinandersetzung ein Ausgangspunkt deines Buchs?
Birgit Birnbacher: Marie Jahoda ist eine spannende Persönlichkeit gewesen. Als Sozialforscherin hat sie dafür plädiert, dass man nicht vom Schreibtisch aus forschen, sondern dort hingehen muss, wo die Menschen leben. Diese Niedrigschwelligkeit hat sie in ihre wissenschaftlichen Schriften übertragen. Sie hat die Menschen beforscht und für die Menschen darüber berichtet. Das spricht mich sehr an. Für dieses Buch war sie wichtig, weil sie viel über die Arbeit und Tätigkeiten von Arbeitslosen geforscht hat. Ich habe mich gefragt, was Arbeitslosigkeit im 21. Jahrhundert bedeutet, in dem wir aktuell die Situation haben, dass es viel mehr Stellen gibt, als besetzt werden können. Und in dem die Arbeit für viele – nicht für alle – etwas sein soll, das das Lebensglück erfüllt und nicht nur für die Versorgung zuständig ist. Die Arbeitslosen in meinem Buch sind deshalb auch Arbeitslose des 21. Jahrhunderts. Sie sind nicht betroffen im Sinne einer Werksschließung, haben nicht damit zu kämpfen, dass sie nichts mehr kriegen, sondern sie sind Menschen mit Optionen, Menschen, die etwas suchen und die ahnen, dass es noch mehr gibt im Leben.
Der Roman spielt ja, auch wenn es nicht eindeutig ausgesprochen wird, im Salzburger Innergebirge, wo du selbst aufgewachsen bist. Da stellt sich natürlich die Frage nach dem biographischen Bezug.
Das kann ich vielleicht einfach anekdotisch beantworten. Ich habe das Manuskript, als es fertig war, einem befreundeten Schriftsteller zum Lesen gegeben, und der hat gesagt: “Hinten bei den Hinweisen, in denen steht, dass alles frei erfunden ist, und jedes Aufeinandertreffen mit der Wirklichkeit zufällig ist, da habe ich sehr laut gelacht.” Ich glaube, das kann man so stehen lassen.
Ein starker Gegensatz im Buch ist jener zwischen männlicher und weiblicher Arbeit. Inwieweit ist Wovon wir leben ein feministischer Roman?
Ich habe versucht, zu zeigen, dass wir meilenweit von einer fairen Aufteilung der unbezahlten Arbeit entfernt sind und ich habe versucht, ein paar komplexe Fragen zu stellen, so dass sie einfach rüberkommen: Wie und wovon wollen wir leben?
Ein gängiges Phänomen ist ja beispielsweise schon, dass von Frauen bestimmte Arbeiten erwartet werden, die von Männern meist nicht eingefordert werden. Stichwort: Care-Arbeit.
Gestern habe ich ein Gespräch geführt, in dem eine Frau gesagt hat: “Aber Männer können doch nicht pflegen”. Das ist glaube ich ein riesengroßes Missverständnis, bei dem wir uns zumindest in unserer Generation einig sind, dass das so nicht stimmt. Umgekehrt stört mich an einer bestimmten Art des Apell-Feminismus manchmal, dass er der Lebenswirklichkeit, die ich erlebe, überhaupt nicht entspricht. Ich erlebe in meinem Umfeld eigentlich nur noch Männer, die sich um die Kinder kümmern, die in Karenz gehen, die sich die Aufgaben teilen. Ich vermisse manchmal, dass man nicht dazu sagt, dass es das jetzt auch gibt. Das halte ich in beiden Richtungen für ein unvollständiges Bild. Genauso wie es nicht wahr ist, dass Männer nicht pflegen können, ist es auch nicht wahr, dass nichts sich verändert, vor allem in unserer Generation. Da herrscht in gewissen Milieus heute schon ein anderes Bild, was natürlich nicht heißt, dass es nicht noch genügend Missstände gibt.
Ein weiterer Gegensatz im Roman ist jener zwischen den alten Hacklern, die nicht mehr arbeiten dürfen, weil ihre Fabrik zugesperrt hat, und Julia, der jungen Protagonistin, die nicht arbeiten kann, weil sie krank geworden ist.
Da war für mich die Frage: Wie konstruiert sich eine Identität? Die Fabrik-Arbeitslosen sind vollkommene Arbeiter, Arbeiter auf Lebenszeit. Und alles, was sie sind, tun sie als Arbeiter. Sie haben ihr Haus als Arbeiter und sie gehen ins Wirtshaus als Arbeiter. Und sie erleben ihre Freizeit als Arbeiter. Wenn sie das nicht mehr sind, haben sie auch alle anderen Dinge nicht mehr. Dem habe ich die Identitäten von Julia und Oskar entgegengesetzt. Sie ist noch teils in diesem alten Muster verhaftet, obwohl sie es nicht sein will, und er hat eine fast fluide Identität und schmeißt sich ins Abenteuer. Die beiden sind sehr unterschiedlich und haben ganz verschiedene Voraussetzungen, und das nicht zuletzt, weil sie eine Frau ist und er ein Mann.
Oskar, eine der Hauptfiguren, bekommt im Buch für ein Jahr ein bedingungsloses Grundeinkommen und geht mit einer großen Leichtigkeit durch den Roman. Ist diese Form von Absicherung auch außerhalb dieser Erzählung etwas, das Menschen mehr Freiheit ermöglichen würde?
Ich habe versucht, anhand von Oskar zu zeigen, dass Geld allein nicht die Lösung ist, um auf gute Ideen zu kommen. Auch Zeit allein ist es nicht. Ich glaube, dass in dem Buch steht, dass Resonanzerfahrungen, also Begegnungen mit Menschen, die etwas in uns auslösen, sehr viel ausmachen. Wenn ich das nicht habe, bringt auch alles andere nichts.
Julia bekommt zwar kein Grundeinkommen, im Laufe des Romans hat sie aber die Chance zu einer beruflichen Neuorientierung. Ist es Zufall, dass sie etwas ganz anderes macht, als ihren vorherigen Beruf in der Pflege?
Julia hat so lange einen Pflegeberuf ausgeübt und das ist etwas, was sehr meinem eigenen Leben entspricht. Ich habe fast zehn Jahre Menschen mit Behinderung betreut und gepflegt und weiß, wie anstrengend das ist – psychisch und körperlich. Julia sehnt sich nach etwas ganz Kühlem, etwas, das menschlich nichts verlangt von ihr. Sie will etwas mit dem Bleistift zeichnen oder vor dem Computer sitzen. Das ist der Gegensatz zu dem, was sie vorher gemacht hat. Sie muss sich nicht auseinandersetzen mit menschlichen Bedürfnissen.
Ohne zu viel zu verraten: Der Roman hat ein sehr starkes Ende, das uns beim Lesen sehr mitgenommen hat. Wie sind die Reaktionen darauf?
Da gibt es sehr unterschiedliche Reaktionen. Manche sagen, sie verstehen es nicht. Manche wollen es nicht wahrhaben. Andere sagen, es ist einfach nur bitter. Das Ende ist mir auch beim Schreiben nicht leicht von der Hand gegangen, weil ich mir irgendwie dann doch für die Beteiligte etwas anderes gewünscht hätte, aber schließlich ist es, bedenkt man alles, was in dem Buch steht, nur konsequent: So enden Frauenleben auch. Die Menschen, nicht nur Frauen, tun Dinge aus Liebe. Menschen lieben ihre Kinder und bringen Opfer. Und ich glaube, Frauen bringen nach wie vor andere Opfer, als Männer. Unter diesem Stern ist auch das Ende geschrieben.
Was mir daran wichtig ist: Wenn eine Frau Freiheiten hat, ist meistens irgendwo eine andere Frau, die für sie Opfer bringt. So ist das zum Beispiel auch mit meiner eigenen Mutter. Ich könnte meine Lesereisen nicht machen, wäre nicht meine Mutter da, die in ihrer Freizeit und unentgeltlich mitkommt, um auf das Kind aufzupassen. Das finde ich bezeichnend und ich glaube, dass das auch ein wesentlicher Punkt sein wird, wenn wir über unbezahlte Arbeit diskutieren. Was wir tun werden müssen. Wie gehen wir damit um, dass Dinge, die wir aus Liebe tun, eingespeist werden in den Kosmos der Marktökonomie?

Birgit Birnbacher, geboren 1985, lebt als Schriftstellerin in Salzburg. Ihr Debütroman Wir ohne Wal (2016) wurde mit dem Literaturpreis der Jürgen Ponto Stiftung ausgezeichnet, darüber hinaus erhielt sie zahlreiche Förderpreise und 2019 den Ingeborg-Bachmann-Preis. 2020 erschien bei Zsolnay der Roman Ich an meiner Seite.