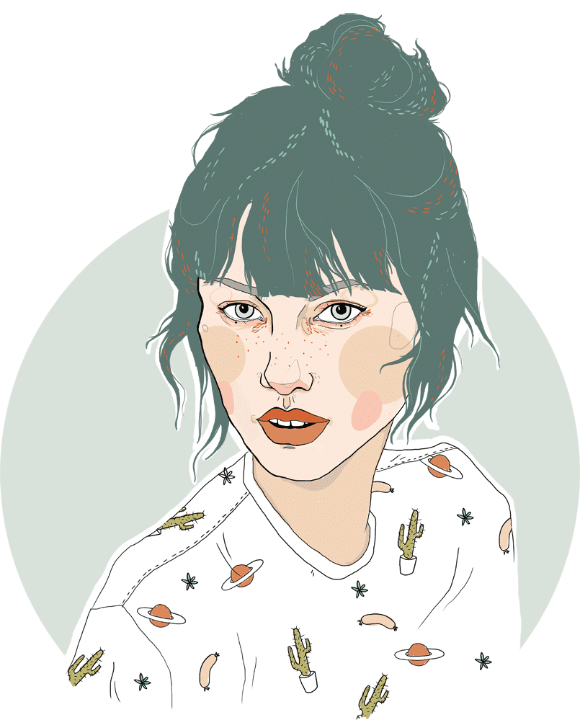Schwanger werden, das Kind etwa neun Monate im Bauch tragen und dann zur Welt bringen. Eigentlich könnte man das Thema Schwangerschaft so in wenigen Worten zusammenfassen, aber damit ist es natürlich längst nicht abgetan. Bevor die werdenden Eltern ihr Kind zum ersten Mal im Arm halten, durchlaufen sie eine mehrmonatige Phase voller Vorfreude, aber auch voller Zweifel und Sorgen, die man so vorher nicht kannte. Die Gedanken drehen sich beispielsweise um die Dicke der Nackenfalte, die Vollständigkeit aller Extremitäten oder die richtige Position der Ohren.
"Früher wurden Anzeichen wie Schwangerschaftserbrechen als positiv wahrgenommen."
Dass das nicht immer die typischen Sorgen und Ängste von Schwangeren waren, erzählt uns Dr. Heinrich Wienerroither, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe in Salzburg: „Bevor es den Mutter-Kind-Pass gab, war die Kindersterblichkeit in Österreich deutlich höher. Im Vorfeld der Geburt gab es auch keine effektive medizinische Abklärung – von außen konnte man ja kaum etwas erkennen und die Ultraschalltechnik war noch nicht ausgereift.“ Früher wurden deshalb Anzeichen wie Schwangerschaftserbrechen als positiv wahrgenommen, denn das bedeutete, dass eine Frau (noch) schwanger war und das Baby im Mutterleib noch lebte.
Wenn ein Ultraschall nicht genug ist
„Aus heutiger Sicht ist es unerklärlich, wie man sich früher auf ein Kind freuen konnte“, fährt Dr. Wienerroither fort. „Es ist in etwa jedes fünfte Kind gestorben und vor 100 Jahren außerdem jede zehnte Schwangere.“ Grundlegend verändert hat das Ganze die Einführung des Ultraschalls. „Bei den ersten Untersuchungen, bei denen ich dabei war, hat man nur gesehen, wie breit der Kopf des Babys war – und die Frauen waren begeistert. Wenn man heute einmal das Gesicht nicht komplett sehen kann, weil sich das Kind nach hinten dreht, sind alle enttäuscht. Und wenn man mich vor 25 Jahren gefragt hätte, ob man einmal einen Fötus in 4D abbilden kann, hätte ich gesagt, Sie schauen zu viel Raumschiff Enterprise.“
Pränatal… was?
Die fortschreitende Technik hat auch das Feld der Pränataldiagnostik revolutioniert. Das sind Tests, die gezielt nach Hinweisen auf Fehlbildungen oder Störungen beim ungeborenen Kind suchen. Dr. Wienerroither erklärt es für Laien: „Der normale Weg einer Schwangeren führt zuerst in die Frauenarztordination. Wenn dort Auffälligkeiten festgestellt werden, geht es meistens im Anschluss in die Pränataldiagnostik.“ Aber auch ohne auffällige Anzeichen kann sich jede Frau für diese Art von Untersuchungen entscheiden. Ab 35 Jahren werden die Kosten dabei von der Krankenkasse übernommen. Die „Klassiker“ unter den Pränatal-Untersuchungen sind wahrscheinlich der Nackentransparenz-Test und – in weiterer Folge – die Fruchtwasseruntersuchung, bei der mit einer Nadel eine Fruchtwasserprobe entnommen wird.
„Aus heutiger Sicht ist es unerklärlich, wie man sich früher auf ein Kind freuen konnte."
Eine 30-jährige Frau liegt mit einem Ergebnis von 1:900 im Normalbereich. Das bedeutet, dass hinsichtlich des Alters der Schwangeren und anderer Faktoren im Durchschnitt eines von 900 Neugeborenen einen Chromosomenschaden in sich trägt.
„Im Grunde geht es in der Frühschwangerschaft hauptsächlich um das Trisomie-Screening“, sagt Dr. Wienerroither. Dabei wird ein so genannter „Combined Test“ an der Schwangeren durchgeführt, eine Kombination aus Ultraschall und Bluttest, bei dem eine Wahrscheinlichkeit herauskommt. Eine 30-jährige Frau liegt beispielsweise mit einem Ergebnis von 1:900 im Normalbereich. Das bedeutet, dass hinsichtlich des Alters der Schwangeren und anderer Faktoren im Durchschnitt eines von 900 Neugeborenen einen Chromosomenschaden in sich trägt. Bis zum Alter von 35 bis 38 Jahren steigen diese Wahrscheinlichkeiten langsam an. Mit 41 oder 42 Jahren liegt die Relation oft bei 1:10.
"Man muss Farbe bekennen, wie man dazu steht, ein Kind mit einer Krankheit auf die Welt zu bringen. Und ob die Krankheit überhaupt ein Grund zu einem Schwangerschaftsabbruch wäre."
Aber was fängt man nun mit diesen Wahrscheinlichkeiten an?
Dr. Wienerroither erklärt: „Man muss Farbe bekennen, wie man dazu steht, ein Kind mit einer Krankheit oder einer Beeinträchtigung auf die Welt zu bringen. Und ob das überhaupt ein Grund zu einem Schwangerschaftsabbruch wäre. Aber das Thema ist so dermaßen subjektiv, dass es hier keine richtige oder falsche Lösung gibt. Bei der Entscheidungsfindung für oder gegen ein Kind müssen sich viele Partnerschaften erstmal bewähren. Faktoren wie die Wohnsituation, die Stabilität der Beziehung oder das Einkommen spielen hier eine wesentliche Rolle.
„Das tückische an der Pränatalmedizin ist, dass sie bei niedrigen Wahrscheinlichkeiten oft den Eindruck erweckt, dass man zum jetzigen Zeitpunkt ein gesundes Kind hat“, sagt Dr. Wienerroither. „Aber es ist absurd zu glauben, dass man ALLES erkennt. Eine Garantie für ein gesundes Kind kann die Pränataldiagnostik nicht geben. Viele Expert*innen nehmen – berechtigterweise – an, dass durch die fortschreitende technische Entwicklung irgendwann die letzte glückliche Schwangere vom Erdboden verschwunden sein wird“, sagt er. „Denn je mehr man sieht, desto mehr Fragezeichen tauchen auch auf.“
Pränatal… was?
Die fortschreitende Technik hat auch das Feld der Pränataldiagnostik revolutioniert. Das sind Tests, die gezielt nach Hinweisen auf Fehlbildungen oder Störungen beim ungeborenen Kind suchen. Dr. Wienerroither erklärt es für Laien: „Der normale Weg einer Schwangeren führt zuerst in die Frauenarztordination. Wenn dort Auffälligkeiten festgestellt werden, geht es meistens im Anschluss in die Pränataldiagnostik.“ Aber auch ohne auffällige Anzeichen kann sich jede Frau für diese Art von Untersuchungen entscheiden. Ab 35 Jahren werden die Kosten dabei von der Krankenkasse übernommen. Die „Klassiker“ unter den Pränatal-Untersuchungen sind wahrscheinlich der Nackentransparenz-Test und – in weiterer Folge – die Fruchtwasseruntersuchung, bei der mit einer Nadel eine Fruchtwasserprobe entnommen wird.
„Aus heutiger Sicht ist es unerklärlich, wie man sich früher auf ein Kind freuen konnte."
Wie viel im Leben möchte man kontrollieren können?
Problematischer sieht Dr. Wienerroither eine Entscheidung im Anschluss an das Organscreening, das normalerweise rund um die 20. Schwangerschaftswoche stattfindet. „Hier wird eine mögliche Konsequenz immer schwieriger, weil man zu diesem Zeitpunkt die Bewegungen des Kindes spürt und die Bindung noch enger geworden ist.“
Personen, die alles im Leben gerne überprüfen, werden diese Untersuchungen eher in Anspruch nehmen, als jemand, der die Dinge nimmt, wie sie eben kommen.
Pränataldiagnostik kann deshalb Fluch und Segen zugleich sein. Personen, die alles im Leben gerne überprüfen, werden diese Untersuchungen eher in Anspruch nehmen, als jemand, der die Dinge nimmt, wie sie eben kommen. “Das hängt häufig mit dem Grundcharakter zusammen“, sagt Dr. Wienerroither. Die Pränatal-Untersuchungen sind aber inzwischen so etwas wie State of the Art geworden. Ab 35 Jahren nimmt es so gut wie jede Schwangere in Anspruch, „wobei selbst über 35 Jahre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass das Kind gesund ist“, ergänzt er. Trotzdem gibt es Erkrankungen, bei denen es durchaus Sinn macht, sich mental und medizinisch vorzubereiten. „Eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte ist zum Beispiel kein großes Problem, aber es schreckt die Eltern natürlich am Anfang. Hier kann man sich aber durch Sitzungen beim Kinderchirurgen informieren und mögliche Schritte vorab planen.“
"Bei all den medizinischen Möglichkeiten übersieht man oft, dass der überwiegende Großteil der Kinder gesund zur Welt kommt."
Alles eine Frage der Wahrscheinlichkeit
Schwangere, die vor schwierigen Fragen im Zusammenhang mit der Pränataldiagnostik stehen, können sich bei ihrem Frauenarzt / ihrer Frauenärztin Rat holen – oder das Krankenhaus als neutrale Stelle aufsuchen. „Das Angebot der Pränatalmedizin empfinde ich grundsätzlich als gut“, sagt Dr. Wienerroither. „Man sollte sich aber die Frage stellen, wie man mit den Wahrscheinlichkeiten umgeht und ob man im Anschluss im Sinne der Erwartungen der Gesellschaft handelt oder in sich hineinhört und eine Entscheidung auf Basis der eigenen Werte trifft.“
Abschließend betont er: „Bei all den medizinischen Möglichkeiten übersieht man oft, dass der überwiegende Großteil der Kinder gesund zur Welt kommt. Diejenigen, die auf die Angebote der Pränatalmedizin verzichten, sich dadurch unterstützt, dass es sehr viele ernste Erkrankungen gibt, die man nicht feststellen kann. Und auch, wenn eine niedrige Wahrscheinlichkeit von 1:2500 herauskommt – was ist gefährlicher? Die Chancen, dass ich am Weg zur Pränataldiagnostik einen Unfall habe oder dass mein Kind genau dieses eine unter 2.500 ist?