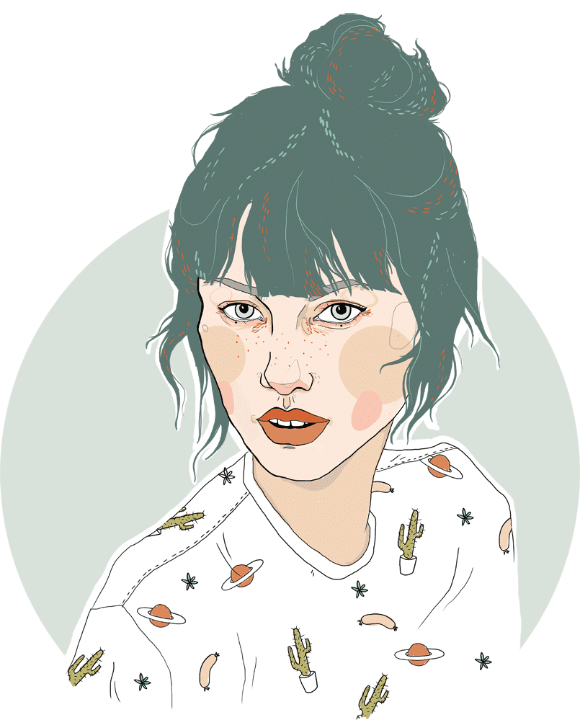Wir haben wieder mal die Salzburger Stadtberge erklommen, dabei das Gestein, auf dem wir rumgelatscht sind, genau unter die Lupe genommen und einen Geologen gefragt, wie stabil unsere Hausberge eigentlich sind.
Weil wir von Haus aus zu Kitsch und Sentimentalität neigen, geht uns jedes Mal das Herzerl auf, wenn wir abends beim Müllnersteg mit einem Bier in der Hand rumlungern und der Abendsonne dabei zuschauen, wie sie die Altstadtfassade in warmes Licht tunkt. Die Salzburger Stadtberge geben diesem Postkartenidyll nochmal einen rustikal-alpinen Touch, sie sind das i-Tüpfelchen für unser ästhetisches Auge.
Die Stadtberge und ihr Gestein
In unserer Vorstellung sind Kapuzinerberg und Co. dabei massive Brocken, die Zeit, Wetter und Winden entspannt trotzen und dabei eben auch noch so verdammt gut ausschauen. Dennoch lösen sich selten, aber nur ganz selten, Steine aus den Stadtbergen und verursachen Chaos und Ratlosigkeit in bei den Stodingern – geschehen so etwa am 23. Jänner dieses Jahres, als sich zwei Felsbrocken mal eben Zugang zum Salzburger Stadtarchiv verschafft hatten. Aber eigentlich sind unsere Stadtberge, wie alle Berge in den Alpen auch, quasi noch in the making. Das hat uns jedenfalls Landesgeologe Rainer Braunstingl erklärt. Mit ihm haben wir uns kürzlich durch das Gestein der Stadtberge gewühlt und ihn gefragt, wieso da überhaupt was abbrechen kann.


„In sechs Tagen wurde die Welt erschaffen, da sieht man natürlich die Husch-Pfusch-Arbeit.“
Rainer Braunstingl ist sozusagen der Haus- und Hofgeologe des Landes Salzburg und beschäftigt sich schon sein Leben lang mit Steinen. Er schreibt etwa Gutachten für Bauverfahren und bei Steinschlägen und berät das Verkehrsministerium. Aus geologischer Sicht ist ohnehin nix fix in den Alpen, sagt er zu Beginn unseres Spazierganges, deshalb bröckelt es eigentlich immer mal wieder. Und er schiebt gleich einen alten Geologenwitz hinterher: „In sechs Tagen wurde die Welt erschaffen, da sieht man natürlich die Husch-Pfusch-Arbeit.“
Für die Alpen ist die Welterschaffung auch noch gar nicht zu Ende, heben sie sich doch nach wie vor noch heraus, weil die tektonischen Platten unter ihnen immer noch in Bewegung sind. In Erdzeitaltern gemessen sind die Alpen ein jüngeres tektonisches Gebirge, erklärt er. Am Großglockner, dem höchsten Berg Österreichs, lässt sich das gut messen: Er wächst jedes Jahr etwa einen Zentimeter in die Höhe. Weil aber die Witterung fleißig an ihm rumschleift, bleibt er dennoch übers Jahr hinweg gleich groß.

Dafür, dass unsere Alpen also ein unfertiges Projekt der Schöpfung sind, sind sie dennoch erstaunlich stabil. Und auch in Salzburg muss sich niemand davor fürchten, beim Bummeln durch die wiedereröffneten Läden in der Linzergasse von herunterprasselnden Steinen erschlagen zu werden, versichert Braunstingl auf dem Weg zum Kapuzinerberg. Obwohl sich dieser am Rande der sogenannten ISAM-Störungszone befindet, die zwischen Innsbruck, Salzburg und Amstetten verläuft. Entlang dieser Linie kommt es zu senkrechten Blattverschiebungen im Gestein, was zur Folge hat, dass ab und zu mal was abbricht.
Wenn die Natur eine Felssprengung unternimmt
Außerdem dehnten sich die Berge und Täler der Alpen erst sehr spät – in der vor 20.000 Jahren stattfindenden Würm-Eiszeit – aus und wurden etwas zu steil geschliffen. Da brökelt es gerne mal nach. Andererseits ist es unter anderem dem doch harten Gestein zu verdanken, dass der Kapuzinerberg stabil bleibt: Festungsberg und Kapuzinerberg werden geologisch zu den nördlichen Kalkalpen gezählt, die Grenze verläuft über Staatsbrücke und Untersberg. Und das Kalk-Dolomitgestein hält den Berg ganz gut zusammen.
An der Nordwand des Kapuzinerberges, wo der Berg im Jänner ins Salzburger Stadtarchiv in der Glockengasse spaziert ist, ist dennoch passiert, was bei Tauwetter eben gern mal vorkommt: Wasser ist durch Schnee und Regen in die mäßig durchklüftete Plattenkalkwand eingedrungen und der Frost-Tau-Wechsel hat dafür gesorgt, dass gleich zwei große Steine aus dem Fels gesprengt worden und talabwärts gepurzelt sind. Vorhersehen konnte man diesen Felssturz im Jänner nicht, sagt Braunstingl: „Das war höhere Gewalt, da kann man nichts machen.“ Was aber nicht bedeutet, dass der Kapuzinerberg sich selbst überlassen wird und jeder Felssturz wie ein Zufall der Natur gehandelt wird, fügt er hinzu.

Es gibt in den Felswänden Kluftspione, das sind kleine Gläser in den Klüften, die leicht zerbrechen, sobald die Klüfte sich öffnen und so früh genug warnen. Außerdem werden kritische Klüfte mit Spritzbeton gesichert und die Kraft in den Berg geleitet. Und zweimal im Jahr kraxeln die famosen Bergputzer durch die Wände. Damit nicht genug: Die Dienstelle Wildbach- und Lawinenverbauung hat erst kürzlich ein Rundumkonzept erstellt, welches alle Maßnahmen bündeln soll. Im Herbst soll es verhandelt werden. Und trotzdem bleibt ein Rest Ungewissheit. Man nennt das halt Natur.
Der Mönchsberg ist anno 1669 in die Stadt abgebrochen und hat etwa 220 Menschen unter sich begraben.
Auf dem Aussichtspunkt beim Kapuzinerschlössl verweilt Rainer Braunstingl und deutet auf die Stadtberge jenseits des Flusses. Die Grenze zwischen der Kalkinsel Festungsberg und dem Mönchsberg setzt der Almkanal, er wurde dort im Mittelalter reingeschlagen. Braunstingl glaubt aber, Hinweise gefunden zu haben, die auf einen viel älteren, römischen Stollen hindeuten, das er erzählt er so nebenbei. Das Gestein vom Mönchsberg ist weicher und deshalb weniger stabil. In der Fachsprache ist von Nagelfluh die Rede, ähnlich hart wie Kalk und nur wenig zerklüftet. Einige Risse am Neutor stehen zwar derzeit unter Beobachtung, aber auch sie werden mit Beton verschlossen und streng überwacht.
Der Mönchsberg ist der wilde Hengst unter seinen Brüdern, davon erzählt auch die Salzburger Stadtgeschichte. So ist der Berg anno 1669 in die Stadt abgebrochen und hat etwa 220 Menschen unter sich begraben. Geschehen ist der Bergsturz oberhalb der heutigen Ursulinenkirche, am Beginn der Gstättengasse. Damit war die Unglücksnacht aber noch nicht vorbei: Natürlich sind sofort Geistliche – und davon gab es in Salzburg viele – zu den Felsmassen geeilt, um den Sterbenden die letzte Salbung zu geben. Viele von ihnen wurden zwei Stunden später von einem Nachsturz erschlagen, etwa dreißig Kleriker sollen es gewesen sein.

Einen größeren Bergsturz gab es in der jüngeren Stadtgeschichte Salzburgs nicht. 350 Jahre später haben Historiker*innen und Geolog*innen wie Rainer Braunstingl die Ursachen des Bergsturzes bestens erforscht und können sagen: Der Auslöser des Bergsturzes war nicht, wie von den Zeitzeugen behauptet, ein rachsüchtiger Gott, sondern ein gewöhnliches Gewitter. Und auch der Mensch war nicht unbeteiligt am Unglück. Viele Bürger*innen gruben damals Zimmer in den Mönchsberg und höhlten den Berg somit von unten aus. So weiß man aus Ortschroniken von Berichten über diese ohne Baugenehmigung in den Fels geschlagenen Höhlen. Durch das Gewitter an jenem verhängnisvollen Abend füllten sich die wenigen senkrechten Klüfte mit Wasser, der hydraulische Druck wurde größer und der geschwächte Felsfuß konnte ihm nicht standhalten. Schließlich hat es rumms gemacht.
„Mehr Niederschlag bedeutet mehr Wasser in den Felsklüften. Das friert zu Frost oder schmilzt wiederum zu Wasser. Ein rascher Wechsel zwischen diesen Stadien könnte Felsstürze begünstigen und zum Problem werden.“
Vor derartigen Tragödien ist die Stadt Salzburg Stand heute natürlich weitgehend sicher – dank modernen Überwachungsmethoden und eben auch dadurch, dass nicht mehr wild im Stein rumgebohrt wird. Mit zunehmender Klimaerwärmung, wendet Rainer Braunstingl ein, könnte aber auch der Niederschlag zunehmen. Mehr Niederschlag würde bedeuten, dass mehr Wasser in Klüfte eindringt und dort zu Frost friert oder wiederum von Frost zu Wasser schmilzt. Ein rascher Wechsel zwischen diesen Stadien könnte Felsstürze begünstigen und zum Problem werden.
Weil seit dem Bergsturz am Mönchsberg aber auch noch die Bergputzer zweimal jährlich durch die Stadtberge fegen, lässt sich das meiste Risiko schon vorab erkennen und eliminieren. Mit all diesen Maßnahmen, beruhigt Braunstingl, sind die Stadtberge eigentlich eh ganz safe. Nicht zu Hundertprozent stabil, aber wenn uns Corona eines gelehrt hat, dann, dass eh nix so richtig fix ist.
Titelbild: Nathan Dumlao / Unsplash